
Texte zum INTeF und
seiner Geschichte
2018
Beginnen: Neu, Wieder, Anders und Besser
Bedingungen und Leistungen des Instituts für Neue Technische Form in Darmstadt 1952–2018
„Die Spitzen und Schornsteine der Städte sieht man schon von Weitem. Die Wälder und Wissen sind grün und gelb […] und irgendwie hat man die vage Hoffnung, es werde nicht ganz so schlimm sein in diesen Städten. Aber dann beginnen die Krater in der Strasse, die ausgebrannten Gerippe der Vorstadthäuser. Wir nähern uns der Stadt-Mitte und da herrscht unmenschliche Verwüstung. Man hat dafür Worte wie beschädigt, zerbrochen, vernichtet, nichtreparierbar gebraucht, – im Herzen der deutschen Städte entdeckt man, wie völlig unzureichend sie sind. Man kann nicht mehr von Beschädigung sprechen, wenn der beschädigte Gegenstand gar nichtmehr da ist. Wir fragen einen Mann nach der Richtung, aber als wir seinen Angaben folgen wollen, bemerken wir, dass er eine Stadt und Strassen beschrieben hat, die nur noch in seiner Einbildung existieren. Über allem liegt ein Hauch von Unwirklichkeit. Die Leute schlängeln sich durch Schutthaufen, geben ihnen Namen von Strassen, von öffentlichen Gebäuden […] die Menschen scheinen dieses Leben für ausgemacht, für wahr hinzunehmen, den Staub, die Keller-Höhlen, die einfach unfassbaren Schwierigkeiten und Entbehrungen; alles dies ist noch Leben, noch Heimat für sie.“
So beschreibt ein ungenannt gebliebener amerikanischer Offizier in der Deutschen Exilzeitschrift „Deutsche Blätter“ (Nr. 27, Sept.-Okt. 1945) einen Aufenthalt in Köln und Aachen, es könnten auch viele andere deutsche Städte sein, auch Darmstadt. Diese Stadt war einmal eines der wichtigsten kulturellen Zentren der Bundesrepublik Deutschland, und zu dieser Bedeutung trug auch das Institut für neue technische Form (im Folgenden INTeF) bei. Wie es dazu kam und was das INTeF in mehr als 65 Jahren seit 1952 geleistet hat, das will dieser Beitrag in einigen Aspekten beleuchten.
Deutschland 1945, das ist ein nach Diktatur und Krieg verwüstetes im Umfang reduziertes Land, aufgeteilt in Besatzungszonen, ohne Zentralregierung. Die wirtschaftlichen Folgen von Krieg und Vernichtung erreichen jetzt die Bevölkerung, die bis zum Kriegsende durch Raub aus den besetzten Gebieten durchaus versorgt war. Das ist die eine Seite. Zum anderen aber hat die staatlich geforderte Denunziation und Intrige ein Ende, ist erstmals nach zwölf Jahren wieder freie Meinungsäußerung möglich, können sich Interessengruppen bilden. Und dies passiert in großem Umfang, da wird etwa bei Parteiwiedergründungen an die Weimarer Republik angeknüpft, da entstehen aber auch neue Parteien, Zeitungen, Verlage. Die Diskussion, ob es nun um Aufbau, um Wiederaufbau oder um Neubeginn geht, bestimmt nach ersten Lähmungen viele Debatten. Politisch und auch durch die großen Zerstörungen bedingt können sich neue Zentren bilden, Regionen treten an die Stelle des Reiches, mittlere Residenz- und andere Städte lösen Berlin ab. Da mag antipreußisches Ressentiment eine Rolle spielen, aber auch wirtschaftliche Änderungen wie die Grenze zwischen der mitteldeutschen verarbeitenden Industrie und der Bizone spielt eine Rolle.
Die Gewichte verschieben sich also, vor allem bis Ende der 1950er Jahre in Richtung des deutschen Südwestens. Hier – in Stuttgart eröffnet Knoll International seine erste deutsche Repräsentanz und trägt maßgeblich zum Durchbruch des zeitgemäßen Wohnens in Deutschland bei, hier wird – in Ulm – die einflussreichste Ausbildungsstätte nach 1950 für Designer bis heute gegründet, hier sorgen die Landesgewerbeämter in Stuttgart und Karlsruhe für die Vermittlung der Guten Form – die Schweiz ist nicht weit und die Zukunft verheißungsvoll.
Und Darmstadt?
Hier hatte die Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe zu Beginn des 20. Jahrhunderts für Aufsehen gesorgt, hier wurde die weiße, also die nicht kohlelastige Industrie zunächst durch den Großherzog und auch danach gefördert, hier hatte der Spätexpressionismus in der Dachstube eine Heimat; hier verschlief man aber auch die städtebauliche Reform, die etwa das neue Frankfurt unter Ernst May prägte. Hier konnte man nach 1945 über Schuttberge von der Mathildenhöhe bis zum Schloss blicken; hier nahm der Deutsche Werkbund seinen Sitz; hier wurde aus dem regionalen Büchner-Preis der angesehenste Literaturpreis der Bundesrepublik Deutschland; hier kamen bei den Meisterbauten in der Nazizeit missachtete Architekten zum Zug, wenn auch nicht nur; hier gab die Sellner-Bühne dem frühen Konkretschriftsteller Claus Bremer Raum; hier teilten sich das INTeF und der Rat für Formgebung nicht immer reibungslos, aber doch produktiv das Messelhaus am Westhang der Mathildenhöhe, gefolgt vom Bauhaus-Archiv, für das Walter Gropius einen Bau entwarf, der nun in völlig anderer Stadtlandschaft in Berlin steht; hier war der Oberbürgermeister lange traditionell auch Kulturdezernent; hier gab es eine Bauhaus-Vorkurs und Industriedesign verbindende Werkkunstschule und mit der Darmstädter Sezession einen über die Lokalgrenzen hinausreichenden Künstlerverbund sowie als anarchisches Lokal den Kellerclub; hier sorgten auch die traditionellen Verbindungen des ehemaligen Herrscherhauses für Hochkulturkontakte gerade nach Großbritannien, die für die Freienkurse für neue Musik genutzt werden konnten; zusammenfassend: hier war ein Kulturzentrum, das über die Grenzen der Bonner Republik hinauswirkte, und: Darmstadt war – zumindest zwischen 1952 und 1987, also immerhin 25 Jahre lang und das trotz des zuvor vollzogenen Weggangs des Bauhaus-Archivs, mit Werkbund, Rat für Formgebung, INTeF und auch den Designbereichen der Fachhochschule Darmstadt die Designhauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Was davon übriggeblieben ist, ist – neben der mittlerweile zur Hochschule aufgestiegenen Ausbildungsstätte – das INTeF. Wie aber kam das nach Darmstadt und was macht es so unverwechselbar?

Da ist zunächst der Gründer, Gotthold Schneider, der in der Weimarer Republik zum Kunstdienst stieß, einer evangelisch geprägten, aber überkonfesssionellen Vereinigung für einfache – reformierte! – Formgebung im sakralen Raum. Schneider muss ein sehr kommunikativer Mensch gewesen sein, der unablässig Verbindungen knüpfte, erst recht nach Errichtung der NS-Diktatur, wo der Kunstdienst zwar manche Kompromisse mit den Machthabern schloss, zugleich aber viel von den Werkbund-Postulaten rettete und zunehmend dem sakralen den profanen Raum beigesellte. Kleine Monographien stellten Handwerkliches vor, vor allem aber war es die Deutsche Warenkunde, die Anregungen für das gab, was an Inneneinrichtung jenseits von Repräsentationsmöbeln möglich war. Und ja, es gibt auch Blätter mit Kriegsspielzeug in der Warenkunde, dem Zeitgeist wurde also durchaus entsprochen. Doch sind solche Zugeständnisse durchaus nicht ungewöhnlich für Menschen, die in Deutschland blieben, oder aus den verschiedensten Gründen zurückkehrten. Und es dauerte nach 1945 noch lange, bis Exilierte und Emigranten zumindest zum Teil nach Deutschland zurückkehrten oder dort zumindest zeitweise tätig waren.

Schneider also flüchtet – zusammen mit seiner Frau Ingeborg – in den letzten Kriegstagen aus Ostdeutschland in den Schwarzwald nach Höchenschwand, wo der Sohn Michael geboren wird, und kann später in Darmstadt eine Wohnung im behelfsmäßig wiederhergestellten Ernst-Ludwig-Haus beziehen, sein Nachbar ist der durch die Notkirchen berühmte evangelische Kirchenbaumeister Otto Bartning. Hier beginnt die Geschichte des INTeF. Denn Darmstadt hat 1950 die Darmstädter Gespräche ins Leben gerufen, die Beachtung in der jungen Bundesrepublik finden. 1950 hat sich hier Willi Baumeister gegen Hans Sedlmayr gewehrt, als dieser anlässlich von Das Menschenbild in unserer Zeit gegen die abstrakte Kunst polemisierte; 1951 steht Mensch und Raum in Zusammenhang mit den Meisterbauten der Stadt von Bartning über Neufert bis Taut. 1952 schließlich lautet das Thema Mensch und Technik, und es ist Schneider, der die begleitende Ausstellung von Starkstrombauteilen bis zur Tischleuchte, vom Werkzeug bis zum Wohnmobiliar zusammenstellt. Selbstverständlich werden die neuen Darmstädter Bekannten integriert, Pit Ludwig fotografiert, Hans Hofmannlederer formt Plexiglas, der Rat für Formgebung befindet sich in Gründung, und in Folge der Ausstellung wird noch Anfang Dezember 1952 das INTeF ins Vereinsregister ein getragen, mit Prinz Ludwig von Hessen als Vorstandsmitglied. Ein Foto im Symposionsband zeigt Schneider in einer Gruppe mit dem Bundespräsidenten und Werkbündler Theodor Heuss, dem Oberbürgermeister Ludwig Engel, dem Prinzen, dem der Münchner Neuen Sammlung verbundenen Günther von Pechmann und anderen. Dieses Gruppenbild ohne Dame belegt verschiedenes: Das Interesse der öffentlichen Institutionen an der Kultur, die Kooperation alter und neuer Macht unter Einbeziehung der christlichen Konfessionen, die Kontinuität von Interessengruppen über die Nazizeit hinweg, aber auch patriarchale Herrschaft und die Abwesenheit der politisch und rassistisch zum Exil gezwungenen Verfolgten. Auch in diesen Aspekten zeigt sich das INTeF als typisch für die Gründerjahre der jungen Bundesrepublik.
Schnell baut Schneider das INTeF zum allseits anerkannten Bestandteil der Darmstädter Kultur aus, wovon nicht nur sein Spitzname Kulturkugel zeugt, den man auch als Ehrentitel datterichscher Prägung betrachten kann. Verbindungen mit der Frankfurter Messe und der ebenfalls in Frankfurt ansässigen Göppinger Galerie, die Residenzgemeinschaft mit dem Rat für Formgebung und die Beziehungen zum nachbarschaftlich agierenden Deutschen Werkbund tragen zum Erablierung des kleinen, aber überaus tätigen INTeF bei. Ausstellungen zeigen europäische moderne Gestaltung und Handwerk, die Region wird nicht vergessen, man liegt in der Mitte Westdeutschlands und vermittelt zwischen Industrie und Handwerk, die Zahl der vom INTeF erzeugten Kontakte ist nur zu erahnen. Unterstützung kommt von der Stadt, vom Land, von der Industrie, vom ehemaligen Herrscherhaus, von Privatpersonen, nicht zuletzt von den zahlreichen Vereinsmitgliedern, die dem INTeF öffentliche Wirksamkeit sichern.

Der Tod Gottholds Schneiders 1975 ist eine enorme Zäsur, und zunächst nicht unumstritten die Übergabe der Leitung durch in den Vorstand an Gottholds Schneiders Sohn Michael. Der hatte eigentlich anderes im Sinn, Architektur- und Produktdesigninteressen, und sah sich nun in einer Nachfolge, die zeittypisch kritisch als dynastisch beäugt wurde. Doch erweist sich der Übergang als Glücksfall. Denn Michael, der durch die Familie schon früh mit Gestaltern von Alois Mäckler über Ernst Neufert bis zu Hans-Theo Baumann oder Wilhelm Wagenfeld in Kontakt kam, ist in Darmstadt groß geworden und hat die Kontaktfreudigkeit seines Vaters geerbt. Er ist es, der das bis dahin hauptsächlich vermittelnde und ausstellende Institut zur Sammlungsinstitution von Weltruf ausbaut, mit wenigen Mitarbeitern und aktiver, bis heute kaum gewürdigter Unterstützung durch seine Mutter Ingeborg. Dass Braun-Produkte heute etwa weltweit gesammelt werden, geht auch auf seine Sammlungstätigkeit zurück wie etwa die Betonung der Produktentwerfer bei Braun, und es ist auch dem INTeF zu danken, wenn heute der Name von Dieter Rams als Synonym für Gestaltung aus Deutschland gilt. Es ist auch Michael Schneiders Leistung, das Interesse am Designsammeln zu wecken, die Anfragen aus Moskau oder Tokio bis heute sind hierfür Beleg genug. Vor allem aber ist Michael Schneider, jenseits der viele Lager füllenden Sammlungen vom Alltagsplastik und Wegwerf-Kaffeebechern bis zum Jugenstil-Unikat, für die es bis heute in Darmstadt keine wirkliche Ausstellungsfläche gibt, Sammler von Menschen, ein Genie der Freundschaft. Bei den Eröffnungen kann es passieren, dass Schneider eben noch die Anrede Königliche Hoheit benutzt, um sich wenige Augenblicke später einem Obdachlosen zuzuwenden, für den er in nächster Zeit einen kleinen Aushilfsjob hat.
Über 40 Jahre leitet Michael Schneider das INTeF, Einiges davon ist in diesem Band zu sehen. Aber es sind nicht nur Erfolgsgeschichten. Lange steht ihm der Fachbereich Gestaltung der heutigen Hochschule Darmstadt kritisch gegenüber; eine öffentliche Ehrung dieser Schule, die ihm nicht wenig verdankt und ihm manches hätte leichter machen können, bleibt aus. Die Stadt zieht sich langsam und lange aus der INTeF-Förderung zurück, Rat für Formgebung und Werkbund lassen sich nach Frankfurt locken, Schneider und das INTeF bleiben übrig. Schließlich muss er durch Druck des Design Zentrums Hessen und der Hochschule auch die alten Räume aufgeben, wieder einmal springt Moritz von Hessen ein und stellt Räume im Langen Bäuche am Friedensplatz zur Verfügung. Die Abwehrkämpfe und Umzüge verschlingen viel Zeit, die besser in Ausstellungen und Initiativen geflossen wäre – erinnert sei nur an so großartige Schauen wie die zu Wolfgang Weingart oder Dieter Rams, die Maßstäbe weltweit setzen. 2016 stirbt Schneider.
Doch ist diese zweite große Zäsur wieder kein Ende des INTeF, denn endlich hat die Stadt wieder die Bedeutung und den Wert des INTeF erkannt. In klugen Verhandlungen gelingt es der neuen Geschäftsführerin Ute Schauer, einer seit Jahrzehnten mit dem INTeF verbundenen Architektin, die mit Michael Schneider seit 1976 u. a. die Ausstellung zu den Tagen der Neuen Musik in Darmstadt und einen Ausstellungsteil der Schau Im Designerpark gestaltet hat, zusammen mit dem Vorstand des INTeF und der Stadt das ehemalige Szenelokal Waben – ebenfalls am Friedensplatz – als dritten INTeF-Standort zu sichern. Ein neues Kapitel der jetzt gut 65-jährigen Geschichte des INTeF hat begonnen: Hoffentlich eines mit gutem Ausgang.
Aus:
65+
Designgeschichte und -geschichten
Das Institut für Neue technische Form
Eine Einführung von Jörg Stürzebecher (1961–2020)
2020
Jörg Stürzebecher
Zum Tode unseres langjährigen Mitglieds am 16. August 2020

Es ist schwer, den Nachruf für einen Freund zu schreiben. Wir haben es oft gemeinsam gemacht – ins Stocken geraten, brachten wir uns gegenseitig wieder auf die Spur des Freundes. Es fing 1988 im Rat für Formgebung an. Der war gerade von Darmstadt nach Frankfurt umgezogen und hatte unter Michael Erlhoffs Leitung eine bunte Mitarbeiterschaft versammelt, die sich sofort erstaunlich gut verstand und auch viel gemeinsam hinkriegte. Dabei war auch Jörg Stürzebecher, obwohl er gar keine Stelle dort hatte. Er war immer dabei und immer mittendrin – so wie er überhaupt in der damals für kurze Zeit wieder sehr lebendigen Kunst- und Designszene in Frankfurt und später und dann schon landauf, landab immer mittendrin war und das auch sein wollte, was auch zu Konflikten führte.
Als erstes hatten wir damals, Helge Aszmoneit, Bibliothekarin, Stefan Ott, studentischer Mitarbeiter, Jörg und ich, die Idee, im „Rat“ eine Stuhl-Ausstellung zu machen. Das sehr, sehr breit angelegte Konzept, was wir gerade wiedergefunden haben, stammte wohl von ihm.
Konzept »
Uns wurde freie Hand gelassen und völlig naiv starteten wir dies Unternehmen, indem wir Bettel-Briefe an Möbelfirmen aus dem Branchenverzeichnis aufsetzten und hundertfach vom Sekretariat schreiben und versenden ließen. Wir haben keinen roten Heller gekriegt und die Sache aufgegeben.
Dann machten wir eben etwas anderes. Wir veröffentlichten (Jörg Text und ich Fotos) in der Stadtillustrierten „Auftritt“, dem späteren „Journal Frankfurt“, den Artikel: „Zum Stühle seh’n spazierengeh’n“. Neben Bertoia-Stühlen, die zur Corporate Identity der Reinigungs-Kette Röver gehörten, fanden wir unterwegs u.a. Casalino Esszimmerstühle, Stahlrohrstühle verschiedenster Art, alte und neue Bugholzstühle oder -Hocker, und Eiermann-Stühle in der Deutschen Bibliothek.
Jörgs erste eigene Publikation zur konkreten und konstruktiven Kunst erschien im Auftrag der ,edition + galerie hoffmann‘ in Friedberg-Bruchenbrücken, 1989. Die Auswahl der vorgestellten Kunstwerke trafen Heidi Hoffmann und ,Slu‘ Slusallek mit Jörg gemeinsam, der Titel „das quadratische feuer“ stammt von ihm – (unter der Quadratur des Kreises machte er nichts). Diese Arbeit (beg)leitet den Leser ganz nüchtern bei der Betrachtung der Kunstwerke – zum ,Wiederlesen‘, wie es Stephan Ott an anderem Ort nahelegt.
Erinnerung von Heidi Hoffmann ,edition hoffmann‘ »
Stephan Ott und Jörg arbeiteten über die Jahre mit schmerzlicher Freundschaftspause oft zusammen und eine unter großem Vergnügen für eine Publikation von FSB-Brakel entstandene Arbeit soll hier nicht fehlen.
Zugriff in Brakel »
Zu seinen brillianten Artikeln, Vorträgen, Publikationen (Richard Paul Lohse, 1999 und Anton Stankowski, 2006), Ausstellungs-Ideen und -Umsetzungen (Max Burchartz, 1993) gehörten früher auch Reisen zu Ausstellungen, in außergewöhnliche Städte und Museen – z.B. nach Lódz ins Muzeum Sztuki oder in die Reißbrettstadt Gdynia nördlich von Danzig, und immer fast tägliche Stadtdurchquerungen in Frankfurt und der näheren Umgebung zu Ecken, Containern und offenen Bücherschränken mit vielleicht interessanten Sachen, Flohmarktbesuche, auch eigene Flohmarktstände und Führungen u.a. durch das Neue Frankfurt mit Gästen aus aller Welt.
Dank von Victor Margolin, 1941–2019, Designtheoretiker, USA »
Mit Gunther Rambow, der ihn an die Schule in Kassel holte, begann sein Unterricht, der Allen, die nur einen Funken Interesse aufbrachten, unvergesslich sein wird. Ebenso unvergesslich aber sind auch Jörgs Auftritte während seines Studiums in den 1980er Jahren an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt.
Uni Frankfurt »
Er hat an den Orten, an denen er unterrichtet hat, gelitten: an dem Ausbildungssystem, an dem, was als Gestaltung verstanden wird, an den Studenten, deren Zukunft im Designbereich ihm ziemlich trostlos erschien, gepaart mit deren Oberflächlichkeit und Schludrigkeit und dann an der Bürokratie, was zu teilweise bizarren Konflikten führte, vor allem aber verhinderte, dass er, ohne ordentlichem akademischen Abschluss, eine Professur bekommen hat. Aber die hätte er haben sollen.
Vortrag von Jörg Stürzebecher in der kd-lounge der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz, 2009.
„sprache in ulm“, Video »
Jörgs immense und geradezu wuchernde Sammlung an Büchern, Möbeln, Bildern, Kunstwerken, Schallplatten und sonstigen Dingen aller Art ist durchsetzt mit seinem ungeheuren Wissen, in dem alles, was er aufgehoben hat, seinen Ort hatte. Zur Sammlung gehören denn auch Kinderbücher, Spielzeuge und ganz viele auf der Straße gefundene Sachen, wie plattgefahrene Kronkorken, die so aussahen, wie es seiner ausufernden Phantasie gerade gefiel. Diese Dinge gehen besonders nahe, weil sie weit weg von jedem kommerziellem Nutzen für ihn aber als kostbar neben kostspieligen Sachen angesiedelt waren. Camille Hoffmann: „Nun fehlt uns die Datenbank zur Entschlüsselung der Verknüpfungen.“ Sie ist uns mit Jörg verloren gegangen. Und zu seiner Sammlung bemerkte Jörg: „Von der Straße kommt’s und auf die Straße geht’s.“ – Ja, leider.
Eine lange Freundschaft – samt Freundschaftspause – verband Jörg mit Michael Schneider. Schon 1989 stattete u.a. er unsere, d.h. die vom Deutschen Werkbund getragene, jedoch von ihm und mir organsierte Veranstaltung zum „Euro-Design“ mit Stühlen der INTeF-Sammlung aus. Auch das eine Besonderheit von Jörg, seine Veranstaltungen zu Inszenierungen auszugestalten und Geschenke zu verteilen.
Gerne kam er mit Studenten ins INTeF, zunächst ins Alfred-Messel-Haus auf der Mathildenhöhe, dann ins „langen Bäuche“ und jetzt auch ins „Waben“ unten in der Stadt, wo im Wintersemester 2017/18 sein letzter Unterricht wieder auf Einladung von Sandra Hoffmann Robbiani mit den Studenten der Hochschule zum Thema „A Colourful Spectacle“ stattfand.
Eigentlich sollte es nur ein Besuch von Sandra Hoffmann Robbiani und ihren Studenten werden, aber Klaus Crößmann, Mitarbeiter des INTeF, schlug vor, dass Jörg Stürzebecher passend zu dem Grundlagen-Farbkurs verschiedene Gegenstände, wie Stühle, Schallplatten-Cover der Zeitschrift Twen und Plakate von Wolfgang Weingart, aus der INTeF-Sammlung vorstellt, um zeittypische Farbigkeit zu erläutern.
Sandra Hoffmann Robbiani: „Wie üblich zeigte Jörg uns viel mehr als erwartet – u.a. die von Fleckhaus in Regenbogenfarben gestaltete „edition suhrkamp“.
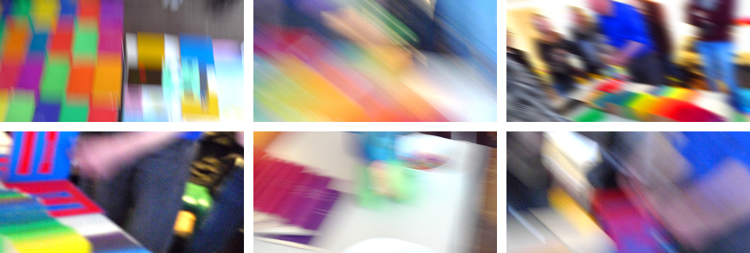
Im Gedenken an Jörg Stürzebecher wird in der vom INTeF gestalteten Ausstellung „auf!gehoben“ auch das für seinen Unterricht eigenhändig aufgelesene Kaffeebecher-Konvolut zu sehen sein. Mit dabei ist auch Henrich Förster, der bei Christof Gassner und Jörg Stürzebecher seine Abschlussarbeit mit den Bänden „Sammler & Sammlung oder das Herz in der Schachtel“ sowie „Teile einer Sammlung oder Sonnenschein in Eimern und Büchsen“ und der dazu gehörigen Ausstellung abgeliefert hat.

Ein Nachruf von Ursula Wenzel
2014
Erstes Deutsches Designinstitut
„Gutes Design ist etwas, das uns Lebensfreude bringt und uns mit unserer Umwelt identifiziert.“
Als erstes Designinstitut in Deutschland wurde das Institut für Neue Technische Form (INTeF) 1952 gegründet. Zu dieser Zeit nannten sich die Designer noch Entwerfer, Formgeber oder Gestalter, denn der Begriff Design wurde erst Ende der sechziger Jahre bekannt und erfährt seit dem eine unglaubliche Multiplikation. Ist heute alles Design?
Das INTeF ist ein Haus mit einer freien Philosophie: es stellt Fragen, reflektiert, vermittelt und begründet. Es ist Schnittstelle von angewandter und freier Kunst, fördert innovative Leistungen und experimentelle Schritte. Nicht der etablierte Kanon wird hier gezeigt, vielmehr wird Design in einen Zusammenhang zu Kunst, Architektur, Wissenschaft und Technik, Gesellschaft und Umweltgestaltung gestellt. So wie sich Design als eine Disziplin ständig neu erfindet, so gibt es Ausstellungen über Hüte, Grafik, Tapeten, Form und Farbe, über Verpackungen und Rollstühle… Die Ausstellung „Design for disabled“ ging um die ganze Welt.
Das INTeF versteht sich als kulturelles Netzwerk, geprägt von der Persönlichkeit seines Geschäftsführers Michael Schneider mit seiner Gabe zur Kommunikation mit Gesprächspartnern aus den unterschiedlichsten Bereichen.
Darüber hinaus besitzt das INTeF eine einzigartige Sammlung deutscher Designprodukte, die Michael Schneider zusammengetragen hat. Mehr als 30 000 Objekte umfasst dieser Fundus, darunter Modelle, Prototypen, Unikate und Erzeugnisse der Alltagskultur, sowie unbeachtete Dinge wie Einwegbestecke aus Kunststoff. So ist das Lieblingsstück des Sammlers der Senflöffel von Wilhelm Wagenfeld aus Kunststoff, der nur selten aufbewahrt wurde. Es ist schwer zu verstehen, das es bis heute noch immer keine Möglichkeit gibt, diese Sammlung dauerhaft zu präsentieren, die in einer Auswahl bereits in Tokio, Osaka, Moskau, in London und anderen Städten gezeigt wurde.
Design ist nie nur Gestaltung am Gegenstand, immer auch Verantwortung und ästhetische Erziehung am Menschen, verstanden als Aufgabe zur Gestaltung unserer Lebenswelt. Eine gute Form zu erkennen, das Handwerk (und die Ressourcen) dahinter zu achten und zu schätzen und unsere Wahrnehmung dafür zu schärfen ist eine der vornehmlichsten Aufgaben des INTeFs.
Darmstadt hätte durchaus deutsche Design-Hauptstadt werden können: Die Designgeschichte begann mit der Gründung der Künstlerkolonie Mathildenhöhe 1899 in Darmstadt. Seit dem gehen von hier stilprägende Impulse für das Verständnis und Entwicklung von Gestaltung aus. In der Nachfolge der Künstlerkolonie-Tradition wurde nach dem Zweiten Weltkrieg die Werkkunstschule gegründet, 1953 der Rat für Formgebung als Informationsinstanz zwischen Wirtschaft und Design. 1960 wurde das Bauhaus-Archiv in Darmstadt gegründet. Mit Unterstützung von Walter Gropius wurde das materielle und geistige Erbe zusammengetragen. Später wurde die Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Werkbundes in Darmstadt angesiedelt, ab 1990 zog das Design Zentrum Hessen in das Alfred Messel Haus. Diese Institution arbeitet als landesweites Kompetenzzentrum für hessische Designer und Unternehmen, es vernetzt Design mit Wissenschaft und Forschung. Die Auswahl mag genügen um das Design-Potential Darmstadts aufzuzeigen.
Gefragt nach der Zukunft von Design in unserer nahezu inflationär durchgestalteten Welt antwortet Michael Schneider: „In Zukunft muss sich das Design zurücknehmen, es muss gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit sorgfältiger durchdacht werden. Wir sind am Ende einer Fülle von einem riesigen Blumenstrauß von Design-Varianten die x-beliebig reproduziert werden.“ Ein Statement für Design, das auf Langlebigkeit, Authentizität und auf Gültigkeit setzt. In Darmstadts Stadtmitte am Friedensplatz, in der Diagonale von kurzweiligem Shoppingglück und dem gerade wieder eröffneten Landesmuseums kann man in den Ausstellungen des INTeF einen spannungsvollen Dialog zwischen Kunst und Kommerz erfahren.
Aus:
ARTMAPP-Magazin, Ausgabe November 2014
Autor: Rita Latocha
1999
Die Clique
Journalistenleben in der Nachkriegszeit
Unsere innere politische Überzeugung blieb zögernd, schwankend, skeptisch. Um die Praxis der Sozialpolitik kümmerten wir uns kaum. Reden und Gegenreden um materielle Fortschritte, Tarifkämpfe, Streiks, hatten mit unserer utopischen Vorstellung wenig zu tun, in der, trotz unseres bürgerlichen Gehabes, immer noch die Hoffnung auf eine veränderte Gesellschaft, auf einen neuen, ehrlicheren Lebensstil steckte.
Für ihn setzten sich Architekten, Designer und Journalisten mit wahrhaft revolutionärem Eifer ein. Alle Dinge des täglichen Gebrauchs sollten einfacher, klarer, ehrlicher werden. Werkbund- und Bauhaus-Ideen, während des nationalsozialistischen Regimes geschmäht und unterdrückt, wurden neu entdeckt, lebten wieder auf, wurden mit Ernst und weltanschaulichem Tiefsinn diskutiert. Institute, Ausstellungen und Zeitschriften belehrten über richtige, gute, ja einzig mögliche Formen von Messern, Gabeln, Löffeln, Gläsern, Tellern, Tassen, Aschenbechern, Vasen, Lampen, Tischen und Stühlen; Formen, die von den Designern kurzerhand „anständig“ genannt wurden. Teppiche, Gardinen und Tapeten unterlagen ihrer strengen Zensur. Liebhaber von Schnörkeln und Ornamenten, Muscheln und Blumen und persischen Mustern verfielen der stillen gesellschaftlichen Verachtung.
Ich weiß nicht, ob es in anderen Sprachen ein so vieldeutiges Wort wie „anständig“ gibt, mit dem ästhetische wie moralische Urteile ausgedrückt werden können. Es klingt allemal kategorisch, selbstgerecht, interessant, ob es für vorschriftsmäßig Kleidung, untadeliges Benehmen oder angenehme Möbelformen gilt.
Der moralisierende Unterton mochte damals stärker durchdringen, weil man mit dem Urvater-Hausrat unbewußt einen Teil der schuldbelasteten Vergangenheit abzustreifen glaubte.
Zwar war in unserer wie in den meisten Familien vom Urväter-Hausrat wenig übrig. Verbrannt, verloren, zerstört das meiste, gerettet ein paar ungeliebte Stücke vom mütterlichen und großmütterlichen Erbe, zum Beispiel der schwerfällige Schaukelstuhl mit eisernen Kufen, der chrysanthemengeblümte Clubsessel, der ägyptisierende Rauchtisch – Konfektionsmöbel der Jahrhundertwende, in meinen Augen längst überflüssiger Plunder, Teil eines verlogenen Repräsentationsbedürfnisses. Neues mußte her: schmucklose, gerade, kantige Tische, Stühle, Betten, leicht einzupassen in die engen Wohnungen der Trümmerstädte. Aus der Not wurde Stil.
„Die Moderne ist durch“, jubelte Gotthold Schneider bei einem Presseempfang in Darmstadt. Sie nannten ihn die „Kulturkugel“, den kleinen Dicken, an dem alles rund war, Kopf, Bauch und Backen. Er strahlte Optimismus aus, war die Seele jener Institute, die sich der Präsentation des neuen Stils verschworen und in Darmstadt, quasi im Schatten des Jugendstils, niedergelassen hatten: als Fortsetzung und Kontrapunkt des künstlerischen Formwillens von 1910, nun aus dem Geist der Technik. Da gab es einen „Rat für Formgebung“ und ein „Institut für neue technische Form“, Tagungen, Ausstellungen, Wettbewerbe. Gotthold, die „Kulturkugel“, der mit seiner Familie im Olbrich-Haus wohnte, organisierte, inszenierte, schaffte Redner und Geldgeber heran. Zusammen mit Mia Seghers, einer stattlichen, betriebsam-rührigen Dame vom Stuttgarter Werkbund, besorgte er die Auswahl deutscher Paradestücke, die nach Mailand geschickt wurden, zur „Triennale“. Ein pompöser Titel. Er bedeutete, daß diese internationale Schau streng ausgelesener moderner Gebrauchsgegenstände alle drei Jahre in den Gewölben der mächtigen Renaissancefestung Palazzo Sforza stattfinden sollte. Da standen oder lagen sie, schlanke Gläser, gediegene Tassen, Chromargan-Bestecke, brav aufgereiht, edel, bieder, sehr deutsch, „anständig“ im Sinne der Materialtreue und Funktionsgerechtigkeit. Wie Hohn auf diese Forderungen wirkte daneben die spanische Abteilung. Im schwarz ausgeschlagenen Kabinett tickte und zuckte ein batteriegetriebenes Herz aus Rubinen in einem Netz aus Brillantperlen, prächtig und widerwärtig zugleich, von Salvador Dali. Eine Gitarre baumelte von der Decke, ein paar ausgetretene Bastschuhe klebten an der Wand. Eisenplastiken von Gonzales spießten gefährlich ins Dunkle. Die Italiener, die Gastgeber, nahmen die „Funktionsgerechtigkeit“ der Waren auch nicht ernst, stellten schief gezogene Keramikschalen in flammenden Farben aus, Kannen und Vasen, gebaucht wie schwangere Frauen, Aschenbecher als offene Hände. Deutsche Besucher lobten sie als „schön verspielt“, andere nannten sie „Kitsch“. Gletscherkühle suggerierten die Schweden mit ihren dickwandigen, schweren Glasgefäßen, die wie aus Eis geschnitten schienen. Überhaupt die Nordländer! Schweden, Norweger, Finnen, Dänen. Im frühlingshaft warmen Mailand traten sie als Exoten auf – nein, als Pioniere eines überraschend neuen „anständigen“ Wohnstils von wunderbar sicherem Geschmack bestimmt, fern jeder Konzession an Kleinbürgerliches, Gefälliges oder großbürgerlich Protziges, fern auch jener volkserzieherischen Absicht, die der strammen Schau der deutschen Edelware anzumerken war. Skandinavischer Wohnstil wurde nach der Triennale beliebt, wurde Mode. Aufregend wie eine Offenbarung erschien die neue, käufliche Dingwelt, die auf uns eindrang nach Jahren, in denen wir uns mit verschlissenen, brüchigen, vielfach geflickten Resten unserer Habe behelfen mussten und behelfen konnten. Das Zeitalter der Askese war vorbei.
[…]


In Darmstadt war immer was los. Gotthold Schneider, der unermüdliche Optimist, hatte wieder ein Treffen von Architekten, Designern und Journalisten arrangiert. Nein, man war nicht mehr einfach Journalistin. Ich war Vertreterin der FAZ. Parlierte – Sektglas in der Linken, durchweichtes Lachsbrot in der Rechten – über Materialgerechtigkeit, Hochhausproportionen, bornierte Stadtplanung, als ein schlanker, graumelierter Herr auf unsere Gruppe zutrat und sich vorstellte: „Otto Bartning“. Er kam rasch zur Sache. Offenbar war ich ihm bezeichnet worden. Unsere Zeitung, meinte er, sei ein anspruchsvolles, intelligent gemachtes Blatt:
„Sie berichten über Literatur und Theater und Malerei. Und wieviel Scharfsinn verschwenden Ihre Kollegen an die Filmkritik! An schnell vergängliche Produkte, die keine Spuren hinterlassen. Da wird gebaut, gebaut, gebaut. Unsere Umgebung verändert sich täglich.“
Aus:
Die Clique, Scherzverlag 1999
Autor: Helene Rahms
1976
25 Jahre Institut für Neue Technische Form
Unter den schon legendären Darmstädter Gesprächen hatte das des Jahres 1952, das unter dem Thema Mensch und Technik stand, besondere Bedeutung und war weithin beachtet worden. Aus diesem Anlass war auch eine Ausstellung von gutgestalteten Gebrauchsgütern veranstaltet worden. Ihr Geschäftsführer war Gotthold Schneider. Die Ausstellung dauerte vom September bis November 1952. Schon kurze Zeit später konnte Schneider allen denen, die es noch nicht wissen, mitteilen, dass im Dezember 1952 in Darmstadt ein Institut für Neue Technische Form unter dem Vorsitz des Prinzen Ludwig von Hessen und meiner Geschäftsführung gegründet worden ist.Einem einmaligen Ereignis sollte Dauer verliehen werden.
In den ersten Nachkriegsjahren waren die Handlungsmöglichkeiten für den einzelnen in einer heute nicht mehr vorstellbaren Weise offen, und die oft improvisierten Aktivitäten von Persönlichkeiten und Gruppen galten mehr als materielle Faktoren. Dabei spielten alte Verbindungen eine wichtige Rolle. So war es auch hier, wo Gotthold Schneider von seiner Arbeit in Dresden und Berlin (Kunstdienst) bekannt war, wo Bartning und seine Freunde vom ehemaligen Werkbund neue Begegnungen arrangierten und Bundespräsident Heuß als Mitglied des Werkbundes selbstverständlich die Schirmherrschaft über die Darmstädter Symposien übernahm. So kann man sich auch leicht vorstellen, dass nach einer Möglichkeit gesucht wurde, die Ideen des Darmstädter Gesprächs zu konkretisieren und in die künftige Gesellschaft einzubringen. Auf diese Weise entstand das Institut für neue technische Form. Otto Bartning schrieb in dem schmalen Katalog der Ausstellung in klassischer Kürze den Grundgedanken nieder, der für die Veranstaltung galt, der aber auch als Wegweiser für das Institut genommen werden kann: Der Mensch weiß, dass er die Technik als ein von ihm geschaffenes Instrument vom Geistigen her bewältigen muss. Die Technik geistig bewältigen aber heißt, ihre Produkte formen und gestalten. Das war immer schon die stille, oft unbeachtete Leistung des Handwerks. Das ist die entscheidende Aufgabe der industriellen Formgebung.
Bei dem Versuch, die damalige Situation zu skizzieren, darf auch nicht die Mitteilung von Prinz Ludwig und die finanzielle Hilfe der Stadt Darmstadt vergessen werden, zumal sich darin auch das Bestreben zeigt, die kulturelle Tradition, die um die Jahrhundertwende in der Künstlerkolonie progressive Tendenzen proklamierte, wiederaufzunehmen und für die Zukunft fruchtbar zu machen. Das macht Darmstadt keine andere Kommune in der Bundesrepublik nach.
Die Arbeit begann rasch. Aus unserer Zusammenstellung der Veranstaltungen des Instituts geht u. a. hervor, dass es allein auf der Frankfurter Messe 25 Sonderschauen Die gute Form veranstaltet hat und von vornherein darauf bedacht war, sich nicht auf einen zu begrenzten Sektor einzuengen, sondern möglichst viele Aspekte des Designs und Nachbarbereiche einzubeziehen (freie Kunst, Handwerk, Architektur, Psychologie, Soziologie, Pädagogik etwa). Mit einem Wort: Design wird mit kritischem Erfassen, Reflektieren und bewusstem Gestalten der Umwelt gleichgesetzt. Die Endlichkeit, als Begrenzung und Erschöpfbarkeit unserer Lebensbedingungen, ist uns in jüngster Zeit deutlich sichtbar geworden. Die daraus sich ergebende Notwendigkeit, mit dem vorhandenen Kapital an Kräften und Reserven sparsam umzugehen, zwingt zu überlegtem Produzieren und Gebrauchen. Das ist der Ansatzpunkt für die gegenwärtige und vor allem künftige Institutsarbeit. Auf diese Weise erhält der – wohl aus dem Thema des Darmstädter Gesprächs abgeleitete – Name des Instituts neue Dimensionen. So jedenfalls verstehen Moritz Prinz von Hessen, der heutige Vorsitzende, und Michael Schneider, Sohn des Gründers und Geschäftsführer, die Funktion des Instituts.
Dass unter solchen Aspekten modische Spielereien, die auf einen schnellen Erfolg zielen, keinen Platz haben, versteht sich fast von selbst. Vielmehr ist dem Institut immer wieder die Aufgabe gestellt, Produkte zu fördern und zu propagieren, die Gültigkeit von langer Dauer haben. Damit wird mittelbar auch ein wirtschaftlicher Effekt erzielt, weil die Firmen, die in die Gestalt guter Formen investieren und damit ein Risiko wagen, ermutigt werden. Andererseits haben aber die letzten Jahrzehnte gezeigt, dass Risiko um der guten Form willen nicht Ruin bedeutet, sondern dass sie an Boden gewinnt und unwiderstehlich überzeugend wirkt.
So greift eins ins andere, und Design, ernsthaft betrieben und vertreten, ist kein abstraktes Glasperlenspiel im luftleeren Raum, sondern vollzieht sich inmitten von Wirtschaft und Gesellschaft. Darüber ist man sich in Darmstadt durchaus im klaren.
Aus:
Kunst und Handwerk, Ausgabe August 1976
Autor: Gottfried Borrmann
1954
Ansprache des Vorsitzenden, des Prinzen Ludwig von Hessen und bei Rhein, gehalten bei einem Abendempfang in Schloß Wolfsgarten anläßlich der zweiten Sonderschau formschöner Industrieerzeugnisse auf der Frankfurter Herbstmesse
Meine Damen und Herren!
Ihnen wird vielleicht auf der Einladung etwas, das wie ein Zwiespalt aussehen könnte, aufgefallen sein. Da lädt ein Prinz, als Vorsitzender eines Instituts für Neue Technische Form, ein. Prinzen sind üblicherweise Vorsitzende konservativer klingender Vereinigungen, und unserem Institut sollte wohl eigentlich zum mindesten ein Dr.-Ing., wenn nicht gar ein Dr. h. c. vorstehen.
Denselben vermeintlichen Widerspruch, der in der Einladung lag, werden Sie auch hier in diesen Räumen schon beim Betreten empfunden haben. Es scheint geradezu paradox, in diesem Zimmer von neuer technischer Form zu sprechen. Paradoxe sind (obwohl meist irgendwo zu verführerisch) oft zum Denken anregend, und so möchte ich Sie bitten, mit mir einen Augenblick bei diesem, dem Paradox von heute abend, zu verweilen.
In diesen Räumen, in denen ich Ihnen von neuen Bestrebungen erzählen will, sind eigentlich nur Sachen, die der verfeinerten Handwerkskultur des 18. Jahrhunderts angehören. Ich bin mit diesen Sachen so sehr aufgewachsen, dass es Jahrzehnte dauerte, bis ich bemerkte, dass sie eine Zeit, einen Zeitgeist wesenhaft Verkörperten, der längst Geschichte wurde. Später entdeckte ich, dass Kenntnis von und Liebe zur Kultur unserer Vorfahren ohne weiteres ganz direkt unruhig macht. Sie gebiert Hoffnung und, Sorge, dass auch unsere Zeit ein echtes Gesicht, eine klare Linie finde, an der sich die Erben einmal (mit Abstrichen und Zutaten, wie sie bei jeder Überlieferung geschehen), Besinnung und Erbauung holen könnten; für mich bedeutet die selbstverständliche Kenntnis alter Dinge einen Wertmaßstab.
So kommt das Paradox zustande, dass für den Empfänglichen eine schöne alte Umgebung, wie diese, zum eigentlichen Ansporn wird, auf ein Zukünftiges zu drängen. Der Sinn für Geschichte macht nur subalterne Geister reaktionär. Der echte Historiker, d. h. der Mann, der das Leben der Vergangenheit liebt, kann nur Neues erhoffen, das, seinen eigenen neuen Gesetzen folgend, die Wahrheit ewiger Gesetze bestätigt.
Aber unser Paradox kann aus den allgemeinen Betrachtungen, die unerläutert immer wie Phrasen klingen, in speziellere Gebiete führen. Fast alles, was Sie hier sehen, sind von Handwerkern gemachte Sachen, echte Handwerkskultur. Der letzte Höhepunkt dieser Kultur liegt günstigstenfalls (ich denke ans späte Biedermeier) hundert Jahre zurück. Eine Aufgabe unserer Zeit liegt, wie mein Vater und seine Freunde schon vor 50 Jahren erkannten, darin, die alte Handwerkskultur durch eine echte Industrie-Kultur (nicht nur Zivilisation) abzulösen; wenn auch hoffentlich das gute Handwerk daneben seinen Platz behaupten wird.
Gerade beim Vergleich von Möbeln und Geräten aus alter Zeit mit unseren Industrieprodukten wird einem klar, dass bisher der technische Fortschritt einen großen Verlust am eigentlichen Wesen der Dinge mit sich gebracht hat. Dieser Verlust brauchte nicht so groß zu sein. Er liegt meiner Ansicht nach im rein merkantilen Stadium der Anfänge des industriellen Zeitalters, das heute noch nicht überall überwunden ist.
Bei jedem Vergleich aber, den man zwischen Produkten der Handwerkswelt und heutigen Industrieprodukten anstellt, spürt man, dass die alten Qualitätsbegriffe auf das Neue nicht immer anwendbar sind. Das alte Handwerksprodukt muß, wie jeder anständige Gegenstand, auch heute noch, materialgerecht und funktionsgerecht sein. Darüber hinaus hat das alte Ding eine eigene Schönheit, ein eigenes individuelles Wesen. Das neue industriell erzeugte Ding ist durch seine Herstellung nie einzig, sondern beliebig oft wiederholbar. Es hat kein individuelles, sondern ein Massenwesen oder -dasein. Dieser Unterschied läßt sich durch nichts vertuschen, er ist echt. Meine Augen sagen mir aber: der Mercedes 300 L ist schön — die Olivetti-Schreibmaschine ist schön usw. Sollen wir uns an der Wiederholbarkeit stoßen?
Nein — der einzige Punkt, an dem unsere industrielle Kultur der Handwerkskultur noch oft unterlegen ist, ist der, dass heute ein guter Geist (oder die Schönheit?) unseren Industrieprodukten oft fehlt, den selbst die biedersten kleinen Handwerker des 18. Jahrhunderts irgendwie verkörperten. Dass dies so ist, liegt daran, dass noch vom 19. Jahrhundert her der merkantile Gesichtspunkt manchmal überbetont wird. Die Industrie hatte und hat auch heute noch mancherorts zu wenig kulturelles Gewissen. Nur eine Katastrophe könnte uns aus unserer heutigen Welt wieder zurück in das Zeitalter des Handwerks versetzen. Dagegen droht die Katastrophe der seelenlosen Vermassung in der übermächtigen Staatsmaschinerie und ihren Bienenhäusern. Die Technik und die aus ihr geborene Industrie ist unser Schicksal. Dieses Schicksal wäre nicht gar so schlimm, wenn die Industrie erkennen würde, dass jedes Gut, (das Wort allein sollte eigentlich verpflichten), dass jedes Gut, das sie erzeugt, das Leben der Abnehmer mitbestimmt. Dass also ein Industrieprodukt einfach nicht gut genug sein kann.
Wann ist aber ein Industrieprodukt gut? Meine private Definition lautet so:
1. Materialgerecht
2. Funktionsgerecht
3. Preiswert
4. Schön
(Ich weiß, dass man heute lieber formschön sagt, kapiere aber den Unterschied nicht ganz und bleibe so bei schön.)
Ich habe beobachtet, dass die Begriffe Material und Funktion als einzige Qualitätskriterien nur auf Dinge zutreffen, die der täglichen Umgebung des Menschen ein wenig entrückt sind. Auch unsere neue, technisch bestimmte Welt braucht darüber hinaus das unangenehm irrationale Kriterium des Schönen (sicherlich für alle Gebrauchsgegenstände). Und wenn wir dies wieder fühlen, geraten wir ganz von selber in die Nähe der alten Handwerkskultur.
Als grundlegender Unterschied bleibt, dass das alte Handwerksprodukt praktisch einmalig ist, das Industrieprodukt seinem Wesen nach beliebig wiederholbar. Dagegen ist aber gerade das Handwerksprodukt weniger eng zeitgebunden als das Industrieprodukt, das eigentlich neu sein muß, um gut zu sein. So befinden wir uns in der Gefahr, statt einen Stil zu entwickeln, in Moden zu verfallen. Der immer wieder neu zu erobernde Umsatz ist hierfür vor allem mit verantwortlich. Die Schwerfälligkeit unserer menschlichen Natur und der Mangel an Investitionskapital möge uns hier vor dem Schlimmsten behüten.
Das klingt wie eine kategorische Verdammung der Mode. Nichts liegt mir ferner, denn ich glaube, dass alle sog. Stile einmal Moden waren und der Gedanke, dass man den allein richtigen Stuhl, gewissermaßen die platonische Idee eines Stuhles, finden — nicht erfinden könnte, erscheint mir schon deshalb verfehlt, weil auf diesem endgültig richtigen Stuhl nur ein endgültig richtiger Mensch sitzen könnte.
Morgensterns Aesthet sagte schon: »Wenn ich sitze, will ich nicht sitzen, wie mein Sitzfleisch möchte, sondern wie mein Sitzgeist sich, säße er, den Stuhl sich flöchte.« Und die Aufgabe der Stuhlfabrikanten besteht, meiner Ansicht nach, darin, dem Sitzgeist sowohl als auch dem Sitzfleisch zu dienen. Ich bin von unserem Paradox »Alte Umgebung — Neue technische Form« scheinbar weit abgekommen. In Wirklichkeit aber hoffe ich ein wenig, wenn auch vielleicht verworren, angedeutet zu haben, was uns, d. h. meine Freunde vom Institut für Neue Technische Form und mich bewegt.
Ich darf, ehe ich Ihnen von unserer Tätigkeit und unseren Hoffnungen und Plänen berichte, kurz zusammenfassen: Wir leben im Zeitalter der Massen, wir hoffen aber, dass die Intelligenz und das Schönheitsgefühl bester Einzelner gerade durch die industrielle Massenproduktion dieser Masse zugänglich wird. Für dieses Ziel möchten wir wirken. Wir sehen die eminent wichtige Aufgabe jeder Industrie darin: Bestes zu bieten (und das geht nur unter Hinzuziehung wirklicher Denker und Künstler) und vielerlei zu bieten (das erlaubt dem‘ Käufer noch ein Minimum von Originalität durch die große Auswahl).
Wir hoffen, dass die Industrie und die Öffentliche Hand (als größter Auftraggeber) erkennen, dass sie eine ungeheure Verantwortung tragen, nämlich die Verantwortung, wie die nächsten hundert Jahre, die ja mit jedem Tage neu beginnen, aussehen werden. Wenn im 18. Jahrhundert ein kleiner Schreiner etwas schlecht machte, schadete das wenig. Wenn der Entwerfer einer Möbelgarnitur heute ein unehrlicher Mann ist, kriegen ein paar Tausend Leute Schund ins Haus.
Es kommt auf Entwerfer, Produzenten und Käufer an, die Brücke zu schlagen vom Zeitalter des gottbegnadeten Handwerks zum Zeitalter nicht der dämonischen, sondern einer gottbegnadeten Technik. Ich hoffe, dass Sie, meine Damen und Herren, dieser »Denkversuch« (Plagiat von Heidegger) über das Paradox dieser Einladung nicht gelangweilt hat. In ihm ist viel vom Wollen unseres Instituts für Neue Technische Form enthalten. Sie wie ich wissen, dass keiner der hier leicht skizzierten Gedanken originell ist, und Sie wie mich interessiert eigentlich hauptsächlich die praktische Form, in der sich diese Gedanken manifestieren könnten.
Außerhalb der eigentlichen Ausstellungstätigkeit, die erst einsetzen konnte, nachdem im Spätherbst 1953 die Räume im Messehaus durch Freundlichkeit des Rats für Formgebung und des hessischen Staates zur Verfügung standen, wurden sowohl der Vorsitzende als auch der Geschäftsführer, Herr Gotthold Schneider, wiederholt um die Mitarbeit bei den Vorarbeiten und der Durchführung der ersten und zweiten Sonderschau für formschöne Industrie-Erzeugnisse während der beiden Hannoverschen Frühjahrsmessen gebeten.
Eine erste sichtbare Arbeit bestand in der indirekten und direkten Mitarbeit an dem Zustandekommen der Internationalen Tapeten- Ausstellung 1953. Diese war zuerst an anderem Orte geplant, Der Verband Deutscher Tapetenfabrikanten konnte aber davon über zeugt werden, dass am Orte der Durchführung des ersten großen Tapeten-Wettbewerbs auch die Internationale Tapeten-Ausstellung veranstaltet werden müßte.
Bereits im August 1953 begannen die Vorarbeiten für die im Januar 1954 eröffnete Kunststoff-Schau. Es wurden im Laufe der Zeit ca. 1500 Kunststoff verarbeitende Fabrikanten angeschrieben. Auf Grund dieser Briefe meldeten sich natürlich nur solche Firmen, die an Hand der von uns angegebenen Richtlinien annahmen, Gegenstände zu erzeugen, die von uns als formschön ausgewählt werden würden. Von diesen etwa 400 Fabriken, mit denen korrespondiert wurde, blieben als Aussteller etwa 120 übrig. Die Ausstellung wurde zu einem Erfolg. Noch heute senden uns Firmen ihre neuesten Produkte, noch heute erhalten wir Anfragen aus aller Welt. Presse und Rundfunk berichteten ausführlich über die von uns getroffene Auswahl. Das Fernseh-Studio Frankfurt brachte ein — zuerst auf acht Minuten angesetztes — dann auf 22 Minuten ausgedehntes Programm.
Als nächste geschlossene kleine Schau in unseren Räumen ist eine Steingut- und Steinzeug-Ausstellung geplant. Auf eine Anfrage des hessischen Finanzministers Dr. Tröger wegen einer Sonderschau formschöner Industrie-Erzeugnisse auf der Frankfurter Messe empfahl der Präsident des Rates für Formgebung, eine solche Schau von unserem Institut durchführen zu lassen. Der Erfolg der ersten Sonderschau auf der Frühjahrsmesse 1954 veranlaßte den Aufsichtsrat der Frankfurter Messeleitung, uns auch während der diesjährigen Herbstmesse mit der Durchführung einer gleichen Veranstaltung zu beauftragen. Die Gestaltung der Ausstellung liegt in den Händen des Architekten Günter Hennig, der auch unsere früheren Ausstellungen gestaltete.
In dieser Sonderschau von Beispielen formschöner Industrieprodukte werden Erzeugnisse von Firmen gezeigt, die, sowieso an der Frankfurter Messe vertreten, sich zur Beteiligung angemeldet haben. Ein Gremium von unserer Ansicht nach repräsentativen Gutachtern, die zum Teil dem Rat für Formgebung angehören, hat die Stücke aus dem Angebot ausgewählt. Die Ausstellung in dieser Sonderschau ist keine Prämiierung, sondern soll nur dem Besucher ein leider noch einseitiges Bild von Beispielen guter Industrieprodukte, die auf der Frankfurter Messe sowieso vertreten sind, bieten. Unser immer wieder ausgesprochener Wunsch ist der, dass von Messe zu Messe mehr Firmen aufgenommen werden sollen und — auch aufgenommen werden können. Die Ausstellung kann am besten das zeigen, worüber ich heute abend so viele Worte machen muß. Sie alle sind herzlich eingeladen, sie zu besichtigen.
Wenn das Institut für Neue Technische Form seiner satzungsgemäßen Aufgabe, der Errichtung einer ständig auf neuesten Stand ergänzten Dauerschau guter Industrie-Erzeugnisse, gerecht werden will, braucht es dazu eigene Räume. Für diese Räume ist ein Neubau erforderlich, der Geld kostet, das wir nicht haben. In absehbarer Zeit muß die große Bettelei darum anfangen, von der ich Sie, meine Damen und Herren, heute noch verschonen möchte. (Ihre Namen sind aber hoffnungsvoll vorgemerkt.) Sie wissen wohl alle, dass ein ähnlich gerichtetes Unternehmen für die Villa Hügel in Essen in jüngster Zeit gegründet wurde. Sie wissen vielleicht nicht, dass schon seit Jahren die Neue Sammlung in München und das Stuttgarter Landesgewerbeamt solche Ziele verfolgen.
Diese Tatsachen entmutigen uns durchaus nicht, denn wir glauben, gerade durch unsere bisher und auf weiteres bestehende räumliche Begrenzung im Hause des Rats für Formgebung am wenigsten der Gefahr der musealen Verkalkung ausgesetzt zu sein, und begrüßen, schon des gemeinsamen Zieles wegen, jede gleichlaufende Bestrebung. Darüber hinaus können wir besonders gut an Ort und Stelle die Bestrebungen des Rats für Formgebung auf einem Teilgebiet unterstützen und demonstrieren. Hierbei sind wir auch ganz besonders für die tatkräftige Mitarbeit der Stadt Darmstadt dankbar.
Nun habe ich mich, meine Damen und Herren, weit von meinem paradoxen Ausgangspunkt entfernt. Ich glaubte aber Ihnen und mir eine Rechenschaft über die Bestrebungen des Instituts, dessen Vorsitzender ich bin, schuldig zu sein. Zuerst wollte ich Ihnen sagen, wie wir die Dinge sehen. Dann wollte ich Ihnen summarisch darüber berichten, was bisher getan wurde.
Ich versichere Ihnen, dass wir mit großer Zähigkeit unserem Ziel, der Humanisierung des Industrieproduktes, nachgehen, und wir bitten auch um Ihr Verständnis für dieses Ziel, dessen Erreichung ein wirklicher Beitrag zur Veredelung des Massenzeitalters sein würde.
Ansprache bei einem Empfang in Schloß Wolfsgarten
Autor: Prinz Ludwig von Hessen und bei Rhein